Journalismus. Für geordnete und gesunde Gehirne: Gestützt auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse plädiert Maren Urner für einen reduzierten, kritischeren Medienkonsum.
„Das Mammut grüßt nicht nur täglich, sondern im Sekundentakt“: So beschreibt Maren Urner die ständige Erfahrung von Stress und geradezu existenzieller Angst, der wir und unsere „Steinzeithirne“ in der digitalisierten informationswütigen Welt des 21. Jahrhunderts ausgesetzt seien. In ihrem Buch „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren“, gibt die Neurowissenschaftlerin fundierte Anregungen für ein entspannteres Leben, einen effizienteren Medienkonsum und wertvolleres „Wissen“. Als Advokatin eines evidenzbasierten „Konstruktiven Journalismus“ rief sie 2016 mit Perspective Daily, ihrem werbefreien Online-Magazin, einen Gegenentwurf zur üblichen Berichterstattung ins Leben.
Anhand von Studien und lebenspraktischen Beispielen veranschaulicht Urner, wie viele Medienschaffende den menschlichen Hang zum Negativen mit Katastrophenmeldungen – „If it bleeds it leads“ – ausnutzen und wie ein obsessiver Medienkonsum, von FOMO („fear of missing out“) begleitet, zur Gewohnheit werden kann. Damit verbundener, anhaltender Stress und Unruhe könnten zu schwerwiegenden psychischen und physischen Problemen führen. Oft hängen wir der Annahme an, in einer multioptionalen und ständig vernetzten, ständig aktualisierten Nachrichtenwelt zumindest so informiert und leistungsstark wie nie zuvor zu sein. Tatsächlich aber sei Multitasking nicht existent, wir also weniger konzentriert. Zudem hätten wir ein wenig umfassendes, viel zu negatives Weltbild. Wenn Journalist*innen dieses propagierten, würden wir nicht motiviert werden, etwas zu ändern, sondern lernen zu denken, dass wir „hilflos“ sind, fallen in ein „neues Biedermeier“ und kapitulieren. Daher argumentiert Urner für einen Konstruktiven Journalismus, der Studien und Einzelmeldungen kontextualisiert und neben Problemen reale Lösungsansätze und –projekte nicht unerwähnt lässt. Zu einem solchen Journalismus gehöre kein Schönreden, sondern ein sorgfältiger und langer Recherche- und Schreibprozess. Journalist*innen sollten Fachmenschen und Akademiker*innen, nicht nur die „Affe[n] am Telefon“ sein, schreibt Urner. In dem Zuge kritisiert sie das Verhaftetsein der wissenschaftlichen Welt im Elfenbeinturm und das damit zusammenhängende Meiden sozialer Medienpräsenz – speziell in Deutschland. Maren Urners journalistischer Gegenentwurf spiegelt sich in Perspective Daily wider, wo fünf wissenschaftlich fundierte Artikel pro Woche erscheinen; samt Kommentarspalte, Literatur- und Quellenangaben.
Die Medienpsychologin glaubt nicht an einen objektiven Journalismus, wohl aber an einen kritischen: So sei Haltung aufgrund von intrinsischen Werten zeigen nicht nur unvermeidbar, sondern auch wünschenswert. Das ständige Hinterfragen und Revidieren eigener Gewohnheiten, Glaubenssätze, Konsumentscheidungen und Falschannahmen sei aber ebenso wichtig, sowohl auf Seiten der Medienschaffenden als auch der Konsumierenden und im gemeinsamen Dialog auf Augenhöhe. Urners Medienmodell ist ansprechend, vermutlich besonders für jene, die der akademischen Welt selbst nicht fremd sind. Ob es aber den Sprung über die Paywall von Perspective Daily, in die werbefinanzierte Medienlandschaft macht; ob es unter den „shouting masses“ wirken und diese (selbst-)kritischer werden können, ist fraglich. Die Suche nach der Wahrheit, die Urner für „vielleicht wichtigste Aufgabe eines jeden Individuums“ hält, führt aber vielleicht auch im Zeitalter des Postfaktischen noch auf neue, klarere Wege.
Was Instagram mit uns macht
Bochumer Forscher*innen haben zu der Auswirkung von sozialen Medien auf unsere Psyche geforscht und veranschaulicht, dass diese einen negativen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl haben.
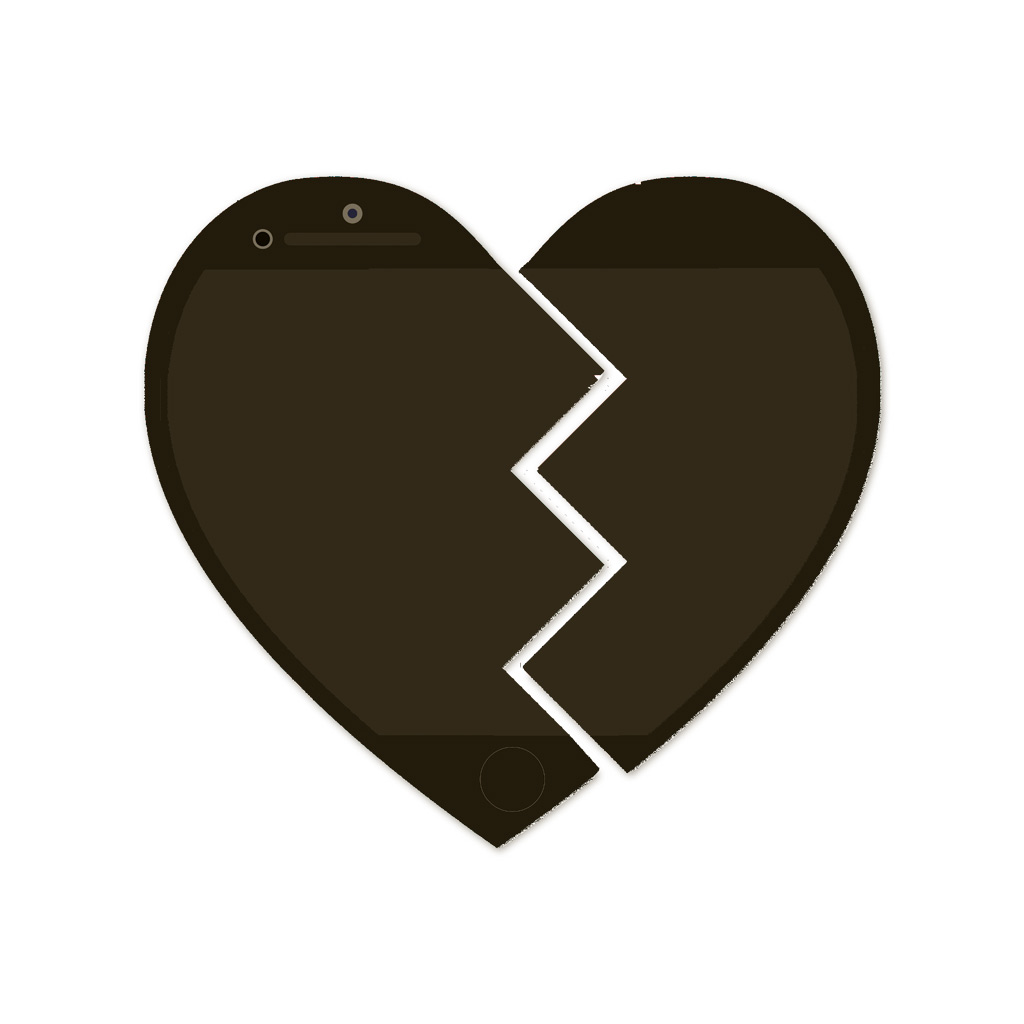 Soziale Netzwerke wie Instagram, Twitter und Facebook sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Lebens vieler Menschen. Nicht nur im privaten Gebrauch, sondern auch beruflich sind sie häufig unausweichlich. Doch wie bei vielen Technologien und gesellschaftlichen Umwandlungen, die weitreichende Folgen auf die persönliche und geteilte Umwelt haben, kam auch bei den sozialen Netzwerken erst die Entdeckung, dann die Erforschung ihrer Auswirkungen. In den vergangenen Jahren vermehren sich deshalb die wissenschaftlichen und kritischen Auseinandersetzungen mit den Plattformen. Facebook ist seit den US-Präsidentschaftswahlen 2016 mit der Kritik an ihrem Geschäftsmodell konfrontiert, das Falschmeldungen und Manipulation durch politische Werbung ermöglicht. Doch auch die geistigen Effekte, wie Suchtspiralen oder das mögliche Auslösen von Depressionen und anderen sogenannten affektiven Störungen sind vermehrt Forschungsgegenstand.
Soziale Netzwerke wie Instagram, Twitter und Facebook sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Lebens vieler Menschen. Nicht nur im privaten Gebrauch, sondern auch beruflich sind sie häufig unausweichlich. Doch wie bei vielen Technologien und gesellschaftlichen Umwandlungen, die weitreichende Folgen auf die persönliche und geteilte Umwelt haben, kam auch bei den sozialen Netzwerken erst die Entdeckung, dann die Erforschung ihrer Auswirkungen. In den vergangenen Jahren vermehren sich deshalb die wissenschaftlichen und kritischen Auseinandersetzungen mit den Plattformen. Facebook ist seit den US-Präsidentschaftswahlen 2016 mit der Kritik an ihrem Geschäftsmodell konfrontiert, das Falschmeldungen und Manipulation durch politische Werbung ermöglicht. Doch auch die geistigen Effekte, wie Suchtspiralen oder das mögliche Auslösen von Depressionen und anderen sogenannten affektiven Störungen sind vermehrt Forschungsgegenstand.
Auch in Bochum forschten Psycholog*innen nun über den Zusammenhang zwischen Depressionen sowie dem eigenen Selbstwertgefühl und sozialen Medien anhand von drei zusammenhängenden Studien. „Tatsächlich posten nur die wenigsten Menschen auch negative Erlebnisse und Erfahrungen in sozialen Medien. Dadurch, dass wir mit diesen positiven Erlebnissen im Netz überflutet werden, gewinnen wir jedoch einen ganz anderen Eindruck“, sagt Dr. Phillip Ozimek, der die Studie leitete, im Gespräch mit RUB-News. Die Psycholog*innen erkannten, dass Versuchsteilnehmende nach dem Betrachten von Profilen deren Inhalte ausschließlich positiv waren, ein geringeres Selbstwertgefühl erlebten. Schon in dieser kurzfristigen Belastung sehen die Forscher*innen einen möglichen Auslöser für depressive Symptome. Demnach sehen sie soziale Netzwerke nicht generell als Auslöser von affektiven Störungen. Entscheidend ist das Nutzungsverhalten. Vor allem eine hauptsächlich passive Nutzung, bei der der soziale Status verglichen wird und ein durch soziale Medien vermitteltes, ins Positive verzerrte Bild davon, wie leicht und unbeschwert das Leben anderer ist, sind ausschlaggebende Faktoren.
Buch:Tipp
 Katherine Ormeerod hat sich mit internationalen Expert*innen der Branche, bestehend aus Influencer*innen, Psycholog*innen und plastischen Chirurg*innen, getroffen und sich mit dem Konsum von Social Media auseinander gesetzt. Sie versucht, aus verschiedenen Perspektiven die Welt der mobilen Kommunikation zu analysieren und ein Mittel zum gesunden Konsum zu finden. Denn durch ihren eigenen Konsum fiel ihr auf, dass das Gefühl des Glücklichseins nur durch Likes und positives Feedback vorhanden war und immer kurzweiliger wurde. Die Journalistin und TED-Talkerin versucht in „Why Social Media is Ruining Your Life“, herauszufinden, wer das eigentliche Problem ist, das Online Portal oder die User*innen und deren Umgang mit den Sozialen Medien. Die übermäßige Nutzung und Suche nach Vergleichen, die oftmals in Neid und Missgunst enden, führen dazu, dass die Unsicherheit der eigenen Person wachse und das führe zum Unglücklichsein. Das Buch ist ein Mix aus wissenschaftlicher Forschung und eigenen Erfahrungswerten, die das Medium an sich nicht kritisieren, sondern das, was der Mensch daraus gemacht hat.
Katherine Ormeerod hat sich mit internationalen Expert*innen der Branche, bestehend aus Influencer*innen, Psycholog*innen und plastischen Chirurg*innen, getroffen und sich mit dem Konsum von Social Media auseinander gesetzt. Sie versucht, aus verschiedenen Perspektiven die Welt der mobilen Kommunikation zu analysieren und ein Mittel zum gesunden Konsum zu finden. Denn durch ihren eigenen Konsum fiel ihr auf, dass das Gefühl des Glücklichseins nur durch Likes und positives Feedback vorhanden war und immer kurzweiliger wurde. Die Journalistin und TED-Talkerin versucht in „Why Social Media is Ruining Your Life“, herauszufinden, wer das eigentliche Problem ist, das Online Portal oder die User*innen und deren Umgang mit den Sozialen Medien. Die übermäßige Nutzung und Suche nach Vergleichen, die oftmals in Neid und Missgunst enden, führen dazu, dass die Unsicherheit der eigenen Person wachse und das führe zum Unglücklichsein. Das Buch ist ein Mix aus wissenschaftlicher Forschung und eigenen Erfahrungswerten, die das Medium an sich nicht kritisieren, sondern das, was der Mensch daraus gemacht hat.
Katherine Ormerod: Why Social Media is Ruining Your Life
ISBN: 9781788400626
:Marlen Farina, Stefan Moll und Abena Appiah

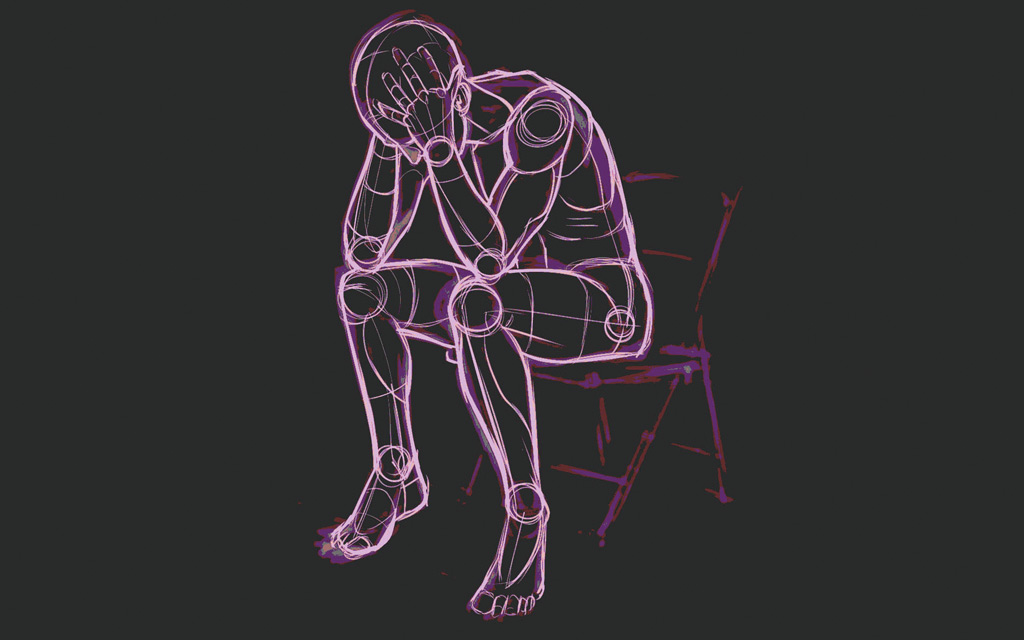
0 comments